Б. Спиноза, Н.В. Гоголь, Ж. Бодрийяр: К спорам о теоцентризме и антропоцентризме
Author
View
Ключевые слова
Лицензия
Copyright (c) 2020 Slavica

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial» («Атрибуция — Некоммерческое использование») 4.0 Всемирная.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY-NC 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
How To Cite
Аннотация
Интерес к проблеме человека, к устройству мира и к его основаниям сближают, при всем различии, Спинозу, Гоголя, Бодрийяра. В выстраиваемом ряду авторов выявляются три основные установки. Спиноза: всё сущее теоцентрично, надо стремиться к постижению Бога и Его «продолжений» (не порождений!) в виде мира и человека. Гоголь: комическо-романтический критицизм в отношении внутримировой иррациональности при устремлении автора к эсхатологической перспективе. Бодрийяр: погружение в пансоциальное в качестве единственно сущего, хотя имеющего (начиная с Ренессанса) пустую основу. Согласно Спинозе, человек, природа, мир, вообще всё в реальности – продолжение Бога. Не «творение»! – именно продолжение, практически составная часть Бога, некие «двойники», хотя те с меньшим количеством «блага». Выходит, что Бог не в состоянии отделить себя от того, что вокруг него, что во внешнем мире и всё, что не Он, считает собою. Гоголь же стремился к изображению человека как реально другого по отношению к Богу и при этом способного меняться (замысел «Мертвых душ»). Разве не «апокалипсис нашего времени» обрисовал Бодрийяр? Его неизменный марксистско-фрейдистский жаргон призван лишь обслуживать непосредственную интенцию реформирования социальной реальности. В бодрийяровской концепции заметен пост- и неоромантический скепсис в отношении природы человека и социума. Внемарксистское (и внефрейдистское) в Бодрийяре – его ставка на «обратимость», на «отдаривание» (в терминологии Мооса и его последователей) «дара», т.е. установка на «символический обмен» между коммуникантами во всех сферах существования. Тем самым Бодрийяр приходит к признанию связки «модерн/постмодерн» и к признанию преимущества модерна. Трансформация «мертвых душ» – путь, о реализация которого на иных основаниях думал также Гоголь и который противостоит самоуспокоенности спинозистских автоматов.
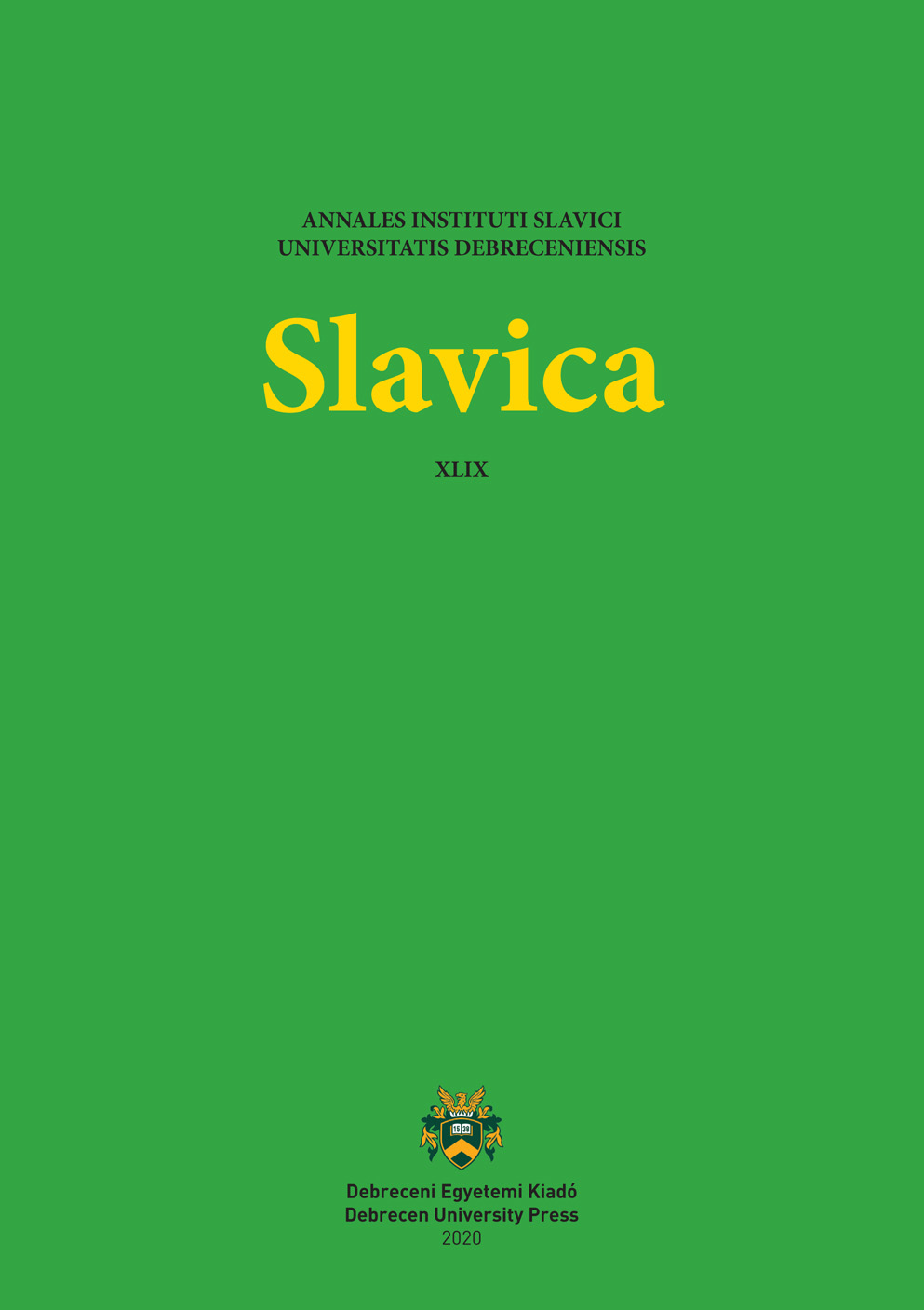
 https://doi.org/10.31034/049.2020.10
https://doi.org/10.31034/049.2020.10